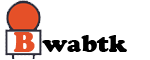Mamaw war zwölf, als sie einen Kuhdieb erschoss. Einige Zeit später machte ein Fremder das Mädchen an: „Ich will dein Höschen essen.“ Ihr Bruder holte ein Höschen und sorgte mit einem Messer in der Hand dafür, dass der Mann seinen Wunsch bis zum letzten Bissen erfüllte. Mit vierzehn wurde Mamaw schwanger. Sie und ihr Freund schlossen sich dem Migrationsstrom an, der in den 1940er Jahren Tausende armer Menschen aus den Appalachen in die neuen Industriezentren des Nordens brachte. Mamaws erstes Baby überlebte nur wenige Tage. Doch ihr Mann fand eine gute Arbeit in einem Stahlwerk in Ohio. Insofern erfüllte sich das Paar den amerikanischen Traum.
Aber tief im Inneren blieben sie Hinterwäldler aus Kentucky. Als Mamaws Mann betrunken nach Hause kam und auf dem Sofa einschlief, übergoss sie ihn mit Benzin und warf ihm ein brennendes Streichholz nach. Sie hatte ihn gewarnt, und nun gebot ihr die Ehre, ihr Wort zu halten. Mamaw sah teilnahmslos zu, wie ihre elfjährige Tochter die Flammen erstickte. Jahrzehnte später lebte ein Enkel bei ihr. Wenn der Teenager den Müll nicht rausbrachte, beschimpfte sie ihn als „faules Stück Scheiße“.

Dieser Junge ist JD Vance, der Investmentbanker geworden ist und nun mit 31 Jahren seine Memoiren veröffentlicht hat. Und „Mamaw“ – oder Oma – war der einzige gute Mensch in seinem Leben. Mit ihr hatte er mütterliche Liebe, einen bewaffneten Zufluchtsort und ein echtes Hillbilly-Zuhause. Vance erzählt von der oft nur oberflächlich gelungenen Integration der Amerikaner mit irisch-schottischen Wurzeln, die die Appalachen in großer Zahl verließen. „Innerhalb von zwei Generationen hatten die umgesiedelten Hillbillies die Einheimischen in puncto Einkommen eingeholt. Doch hinter dem finanziellen Erfolg lag kulturelle Entfremdung.“
Die Mutter wurde zuerst tabletten- und dann heroinabhängig
Das Buch „Hillbilly Elegy“ ist auch die dramatische Geschichte einer Kindheit, in der JDs Mutter ihn erst allein und dann gar nicht großzog. Die zahllosen Ehen und Partnerschaften der Amme endeten in bürgerkriegsähnlichen Kämpfen. Die Mutter wurde tabletten- und dann heroinabhängig. Einmal, nach langer Abwesenheit, tauchte sie bei Mamaw auf, wo JD inzwischen lebte, und befahl ihrem verängstigten Sohn, in einen Becher zu pinkeln. Sie musste eine Urinprobe abgeben, aber sie war wieder high geworden.
In seinem Buch beschreibt Vance den Niedergang jener Industriestädte, die einst mehr als nur Hinterwäldler anzogen. Immer mehr Unternehmen setzen auf Roboter oder finden billige Arbeitskräfte in fernen Ländern. Und doch erzählt Vance eine Erfolgsgeschichte, die kaum zu glauben ist: Nachdem die Marines den Autor nicht nur für den Krieg, sondern auch für das Leben ausgebildet hatten, schaffte er es an die Yale Law School.

Dort wurde ihm nicht zuletzt bewusst, was er bis dahin nicht über die Welt gewusst hatte. Als er mit Ende zwanzig bei einem Rekrutierungsdinner für eine Anwaltskanzlei entdeckte, dass Sprudelwasser existiert, spuckte er es entsetzt aus. „Reich und Arm, Gebildete und Ungebildete, Oberschicht und Arbeiterschicht – ihre Angehörigen leben zunehmend in zwei unterschiedlichen Welten. Als kultureller Emigrant von der einen in die andere Gruppe bin ich mir dessen sehr bewusst.“ Vance gibt zu, dass er sich gegenüber denen, die zurückblieben, manchmal wie ein Verräter gefühlt habe.
Barack Obama, der Außerirdische
Im Wahljahr 2016 kommt sein Buch gerade zur rechten Zeit. Es wirft Licht auf eine Spaltung, die viele Amerikaner verdrängen wollten – eine Spaltung in der weißen Mehrheitsbevölkerung, wohlgemerkt. Den „vergessenen Männern und Frauen“ versprach Donald Trump: „Ich bin eure Stimme.“ Vance erklärt dem Leser eine Parallelgesellschaft, in der Trump Gehör findet. Der Autor zitiert Studien, die seiner Meinung nach das Schicksal der Hillbillies treffend beschreiben – nur dass es in den betreffenden Büchern um Afroamerikaner ging, die aus den Südstaaten in den Norden kamen.
Dass ein Präsident wie Barack Obama unter den Hinterwäldlern als eine Art Fremdkörper gilt, hat wenig mit seiner Hautfarbe zu tun. „Er hat nichts an sich, das den Menschen ähnelt, die ich als Kind bewundert habe“, erklärt Vance. „Sein Akzent – sauber, perfekt, neutral – ist fremdländisch; sein Hintergrund ist so beeindruckend, dass es einem Angst macht; … er strahlt das Selbstvertrauen eines Mannes aus, der weiß, dass die moderne amerikanische Leistungsgesellschaft für ihn geschaffen wurde“ – und nicht für die Arbeiter, die in ihrem Schwärmen von ihrem Ethos der „harten Arbeit“ oft übersehen, wie faul sie sind.
Obama, fügt Vance hinzu, „berührt uns im Herzen unserer tiefsten Unsicherheit. Er ist der gute Vater, der viele von uns nicht sind. … Seine Frau sagt uns, dass bestimmte Nahrungsmittel nicht gut für unsere Kinder sind, und wir hassen sie dafür – weil wir wissen, dass sie recht hat.“ Unter Hinterwäldlern ist es immer noch üblich, selbst den kleinsten Kindern Limonade in die Flaschen zu füllen.
Der Blick von außen auf sein Milieu brach JD Vance fast das Herz. In ihrer teils selbstverschuldeten Armut hatten sich die Hillbillies immer über ihre Liebe zum Vaterland definiert. Doch Helden, zu denen ganz Amerika aufschaut, gibt es nicht mehr. „Wir liebten das Militär, aber in der modernen Armee gab es keinen George Patten.“ Auch das Raumfahrtprogramm bringt keine echten Helden mehr hervor. Fast nichts verbindet die Menschen mit dem Gewebe, das Amerika im Innersten zusammenhält. Nun gibt es Trump und sein Versprechen, „Amerika wieder groß zu machen“. Wenn es etwas gebe, das der weißen Arbeiterklasse fehle, so JD Vance, dann sei es „das Gefühl, dass unsere eigenen Entscheidungen zählen.“