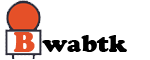Der Niedergang des Herstellers von Kunststoffbehältern ist eine Lektion, die zeigt, wie selbst revolutionäre Marken scheitern können.

Der Haushaltsklassiker Tupperware steht vor der Pleite.
Was haben Tupperware, Kakerlaken und Keith Richards, der Gitarrist der Rolling Stones, gemeinsam? Richtig, sie sind unverwüstlich. Wer die Plastikbehälter kauft, kann sie ewig verwenden. In allen Größen und Farben stapeln sie sich in Küchenschubladen und sorgen für heilloses Chaos. Doch selbst im aufgeräumtesten Haushalt ist Chaos geduldet – denn es scheint ein Naturgesetz zu sein, dass jeder Tupperware-Deckel irgendwann wieder den Weg in die passende Dose findet.
Doch nun könnte bald Schluss sein. Diese Woche kam eine düstere Nachricht aus Orlando, Florida: Tupperware, der Hersteller der Schüsseln, steht vor der Schließung. Wieder einmal, muss man sagen. Das Unternehmen kämpft schon länger mit finanziellen Problemen. Diesmal könnte es das letzte Mal sein.
Am Mittwoch hatte Tupperware in den USA Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen und seine Kreditgeber hatten zuvor darüber gestritten, wie die Schulden von 700 Millionen Dollar umstrukturiert werden sollen. Findet sich nicht schnell ein Käufer für Tupperware, droht dem Unternehmen die Pleite. Im Vorfeld rutschte der Aktienkurs diese Woche auf 51 Cent ab.
Das ist alles seltsam. In Zeiten, in denen die Leute wieder ins Büro gehen und ihr Mittagessen von zu Hause mitbringen, müsste das Geschäft mit Frischhaltedosen eigentlich boomen. Meal Prepping ist die Profi-Variante: Am Sonntag werden alle Mahlzeiten für die Woche vorgekocht, um in der Mittagspause nicht der Versuchung zu erliegen, sich ein ungesundes, überteuertes Sandwich zu schnappen.
Daher werden Aufbewahrungsbehälter benötigt, vielleicht mehr denn je. Warum sind die ursprünglichen Behälter so unbeliebt geworden?
Hausfrauen waren Angebot und Nachfrage
Die Geschichte von Tupperware begann in den 1940er Jahren mit einem Amerikaner namens Earl Tupper und einem Abfallprodukt aus Ölraffinerien, Polyethylen. Tupper hatte herausgefunden, wie man daraus einen haltbaren und gut aussehenden Behälter herstellen konnte. Und mit seinen luft- und wasserdichten Schalen traf er den Nerv der amerikanischen Nachkriegsgesellschaft: Lebensmittel konnten darin länger frisch gehalten werden. Tupper war von seinem eigenen Produkt so begeistert, dass er einen Laden auf der New Yorker Fifth Avenue eröffnete.
Erfolg hatte allerdings erst Brownie Wise, eine alleinerziehende Mutter, die in den 1950er-Jahren auf die Idee kam, die Plastikschüsseln direkt in die Wohnzimmer der Hausfrauen zu bringen. Eine neue Form des Marketings war geboren. Revolutionär waren die Tupperpartys: Sie boten Hausfrauen die Möglichkeit, Geld zu verdienen, indem sie ihren Freundinnen die Produkte persönlich vorstellten. Für jede Dose, die sie der Frau brachte, erhielt eine Verkäuferin eine Provision von 20 Prozent.
Die Behälter prägten einen neuen Lebensstil. Ausgerechnet eine Plastikschüssel wurde zum Symbol für Nachhaltigkeit. Kuchen für Familienfeiern, Reste vom Abendessen, alles wurde in die Behälter gepackt. Und Tupperware wurde, wie Tempo oder Tipp-Ex, zum Synonym für eine ganze Produktkategorie.
Doch die Zeiten änderten sich. Und das Unternehmen, das seine Produkte in 41 Ländern verkauft, konnte plötzlich nicht mehr mithalten.
Direktverkauf statt Onlineshop
Die Tupperware-Partys, einst bahnbrechend, scheinen heute veraltet. Das Verkaufsmodell geht davon aus, dass Frauen tagsüber Zeit für solche Partys haben und abends als gute Ehefrauen agieren: backen, kochen, einpacken. Doch als immer mehr Frauen auf den Arbeitsmarkt drängten, verlor Tupperware seine wichtigste Ressource.
Das Direktmarketing-Modell ist zudem teuer und ineffizient. Weltweit gibt es 450.000 dieser unabhängig agierenden Verkaufsberater, doch der durchschnittliche Umsatz pro Berater liegt schätzungsweise bei lediglich 900 Dollar pro Jahr. Während die Konkurrenz zunehmend auf den Online-Handel setzte, hielt Tupperware stur an seinem Vertriebskanal fest. Noch 2017 erklärte der damalige CEO Rick Goings: „Partys sind immer noch unser Vertriebsmodell.“ Als Tupperware 2022 begann, seine Produkte über Amazon zu verkaufen, war es bereits zu spät.
Harley Krohmer ist Professor für Marketing an der Universität Bern. Er sagt: «Tupperware hat es versäumt, sich an die veränderten Konsumgewohnheiten anzupassen. Der Direktvertrieb ist im Zeitalter des E-Commerce nicht mehr konkurrenzfähig.»
Tupperware erlebte während der Pandemie einen kurzen Aufschwung, weil die Menschen zu Hause festsaßen und viel Zeit zum Kochen hatten. Doch sobald das Leben wieder draußen stattfinden konnte, brach die Nachfrage ein. Gleichzeitig stiegen die Kosten für Plastik, Transport und Logistik stark an. „All das ließ die Gewinnmarge des Unternehmens drastisch schrumpfen“, sagt Marketingprofessor Krohmer.
Es gibt noch Hoffnung
Zudem gibt es mittlerweile unzählige Alternativen zu Plastikschüsseln. Eltern füllen das Essen ihrer Kinder mittlerweile lieber in Edelstahldosen oder verpacken es in selbstgemachte Bienenwachstücher. Auch der schlechte Ruf des Materials hilft Tupperware nicht weiter: Die Angst vor Mikroplastik, das sich beim Gebrauch aus den Behältern lösen kann, lässt viele Verbraucher auf Glas umsteigen.
Wer noch immer eine banale Plastikschüssel verwendet, kauft diese bei günstigeren Anbietern. Tupperware mag zwar qualitativ hochwertig sein, die Produkte lassen sich allerdings leicht kopieren. Behälter, Deckel, das kann heutzutage jeder.
„Der Wettbewerb ist in den letzten Jahren intensiver geworden“, sagt Professor Krohmer. Es gebe inzwischen günstigere Möglichkeiten, sein Mittagessen ins Büro mitzunehmen. Selbst Meal-Prepper suchen mittlerweile auf Plattformen wie Temu und Amazon nach Vorratsdosen für ihr Essen.
„Verlust der Markentreue“ nennt Harley Krohmer das. „In Zeiten des Unterwegsessens hätte Tupperware von seinem guten Ruf profitieren müssen“, sagt er. Doch Innovationen blieben aus. Zwar versuchte das Unternehmen in den vergangenen Jahren, sein Sortiment zu erweitern, doch weder Zitronenpressen noch Pizzaschneider konnten sein Image aufpolieren.
Krohmer fasst zusammen: „Tupperware scheiterte an einer Kombination aus veralteten Geschäftsmodellen, mangelnder Anpassung an digitale Märkte und einem Verlust an Markenrelevanz.“
Doch für Fans der Plastikschüsseln gibt es noch Hoffnung. Tupperware wolle das Geschäft während des Insolvenzverfahrens weiterführen, bestätigte die Schweizer Tochtergesellschaft. Findet sich innerhalb von dreißig Tagen ein Käufer, könnte das Unternehmen vorerst gerettet werden.
Und selbst im Falle einer Pleite bleibt eines sicher: Vorratsdosen werden noch lange Tupperware heißen, auch wenn es das Unternehmen dahinter schon lange nicht mehr gibt.

Hausfrauen sorgten für Angebot und Nachfrage. Im Bild eine Tupperware-Party in den 1950er Jahren. Das Unternehmen entwarf die Hüte, um die Stimmung aufzulockern.