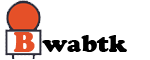Die Stimmung im US-Wahlkampf ist vergiftet wie nie zuvor. Die Kluft zwischen Demokraten und Republikanern zieht sich durch alle Teile der Gesellschaft. Donald Trump sei Symptom und Verstärker dieser Entwicklungen, sagt US-Experte Stephan Bierling – der Ursprung liege allerdings woanders.
Die USA sind gespaltener und verfeindeter als je zuvor seit dem Bürgerkrieg. Der Hauptgrund dafür ist die parteipolitische Polarisierung, die mittlerweile alle Akteure und Institutionen des Landes erfasst hat. Stephan Bierling, Leiter der Professur für Internationale Politik und transatlantische Beziehungen, erklärt im Interview, warum das politische System in den USA immer weniger funktioniert – und warnt vor dramatischen Folgen für die Demokratie weltweit.
WELT: Herr Bierling, Ihr neues Buch heißt „Die UNVereinigte Staaten“ – warum?
Stephan Bierling: Der Titel ist Ausdruck der parteipolitischen Polarisierung, die sich im Laufe der letzten 40 Jahre im amerikanischen politischen System festgesetzt hat und heute jeden Teil der Gesellschaft durchdringt. Die Amerikaner sind sich in der Parteipolitik weniger einig als jemals zuvor in ihrer Geschichte.
WELT: Wie kam es dazu?
Bierling: Nach einer Zeit großer Einigkeit begannen sich in den 1960er Jahren zwei Amerikas herauszubilden: ein konservatives Amerika, das an traditionellen Werten wie Religion und Familie festhalten wollte – und ein liberales, progressiveres Amerika. Das spiegelte sich auch in der Politik wider. Lange Zeit war eine überparteiliche Zusammenarbeit im Kongress eine Selbstverständlichkeit; noch in den 1970er Jahren war ein Republikaner aus Massachusetts deutlich linker eingestellt als ein Demokrat aus Texas. Seitdem haben sich die Parteien neu organisiert und sind ideologisch homogener geworden. 1994 verabschiedeten die Republikaner im Repräsentantenhaus erstmals ein gemeinsames nationales Wahlprogramm und griffen die Demokraten frontal an – mit Erfolg. Seitdem setzen beide Parteien verstärkt auf spaltende Themen wie Abtreibung und Waffenrecht, um Wähler zu mobilisieren.
WELT: Mit welchen Konsequenzen?
Bierling: Die Parteien und ihre Anhänger sortierten sich nach ideologischen Gesichtspunkten. Bald waren alle Konservativen bei den Republikanern und alle Progressiven bei den Demokraten. Diese geschlossenen Parteizirkel radikalisierten sich weiter, weil sie sich nicht mehr mit anderen Ideen und Argumenten auseinandersetzen mussten. Eine parteiübergreifende Zusammenarbeit ist kaum noch möglich, die Parteien stehen sich wie verfeindete Stämme gegenüber. Dies lähmt das politische System und verlagert Konflikte in andere gesellschaftliche Bereiche, etwa in die Justiz oder die Einzelstaaten. Ohne ein Verständnis dieser Spaltung des Landes lässt sich das Phänomen Donald Trump nicht erklären.
WELT: Trump ist also das Symptom dieser Entwicklung und nicht die Ursache?
Bierling: Trump ist Symptom, Nutznießer und Verstärker dieser Entwicklung. Natürlich hat er mit seiner Hetzrhetorik, die in der Lüge von der gestohlenen Wahl und dem Sturm auf das Kapitol kulminierte, den Keil noch weiter in die Sache getrieben. Doch ohne die bereits bestehende parteipolitische Polarisierung hätte er weder eine derart loyale Gefolgschaft um sich sammeln noch die Republikanische Partei übernehmen können. Trump ist wie ein Tsunami auf dieses ohnehin verwundete System niedergestürzt. Und mit seinem animalischen Instinkt für Stimmungen hat er erst die Republikanische Partei und dann die gesamten USA gekapert.
WELT: Funktioniert die Gewaltenteilung, die den US-Präsidenten in seinem Amt beschränken soll, noch?
Beerenling: Die Verfasser der Verfassung hatten vor einer Sache große Angst: vor der Anhäufung von Macht. Deshalb war der Präsident historisch gesehen eine schwache Figur, kontrolliert vom Kongress, der Justiz und den in der Verfassung verankerten Grundrechten. Im Laufe der Zeit wurde die Rolle des Präsidenten schrittweise gestärkt – am deutlichsten unter Franklin D. Roosevelt während der Wirtschaftskrise oder George W. Bush nach dem 11. September. Grundlage dieser neuen Macht war das Vertrauen, dass der Präsident sie verantwortungsvoll nutzen würde. Aber Trump ist ein Autoritärer. Er sagte einmal, dass Artikel 2 der Verfassung – der die Machtbefugnisse des Präsidenten festlegt – ihm die Möglichkeit gibt, zu tun, was er will. Die Verfasser der Verfassung würden sich im Grab umdrehen. Genau das wollten sie mit ihrer Konstruktion verhindern.
WELT: Hängt also die US-Demokratie vom nächsten Wahlergebnis ab?
Bierling: Die Wahl am 5. November ist die wichtigste Wahl meines Lebens. Denn es steht nicht nur die Demokratie in Amerika auf dem Spiel, sondern auch die westliche internationale Ordnung, von der Deutschland in den vergangenen 75 Jahren am meisten profitiert hat. Wenn Trump gewinnt, wird das eine harte Bewährungsprobe für die Demokratie. Er würde eine zweite Amtszeit völlig anders angehen als 2016.
WELT: Inwiefern?
Bierling: Er hatte damals kein Regierungsprogramm und kannte niemanden, mit dem er die wichtigen Posten besetzen konnte. Er hatte Berater um sich wie General Kelly, General Mattis und General McMaster, die ihn auf Linie hielten. Doch je selbstbewusster Trump wurde, desto autoritärer wurde er. Er entließ all diese Generäle und stellte nur noch Ja-Sager um sich. In einer zweiten Amtszeit müssten wir mit jemandem rechnen, der viel besser vorbereitet ist und mit vielen absoluten Loyalisten den Regierungsapparat übernehmen würde. Er würde versuchen, über die anderen Institutionen zu herrschen – das wäre der erste Schritt in Richtung Diktatur. Dass es ihm dabei wenig Hürden in den Weg legen würde, hat das Verfassungsgericht mit seinem Urteil vor wenigen Wochen gezeigt, in dem es die Immunität des Präsidenten verlängerte.
WELT: In diesem Zusammenhang wird das politische System der USA immer wieder kritisiert, nicht zuletzt, weil es Donald Trump 2016 zum Präsidenten machte, obwohl dieser nicht die Mehrheit der Stimmen im Land erhielt. Zu Recht?
Bierling: Das amerikanische Wahlsystem wurde durch die Polarisierung nur deshalb zum Problem, weil die Parteien sie als Instrument ihrer Rivalität nutzten. Politikwissenschaftler argumentieren seit langem, dass Zweiparteiensysteme Mäßigung erzwingen, weil die Parteien sehr unterschiedliche Gruppen ansprechen müssen. Und das war lange Zeit der Fall. Historisch gesehen waren die meisten Bundesstaaten der USA Swing States – das heißt, sie konnten im Prinzip von jeder Partei gewonnen werden. Weil sich die Wähler inzwischen nach Parteilinien sortiert haben, gibt es heute nur noch sieben Bundesstaaten. Alle Wahlkampfausgaben, Kandidatenauftritte und Fernsehspots konzentrieren sich auf diese. Das ist eine starke Einschränkung einer für die Nation verbindlichen allgemeinen Wahl.
WELT: Wie erfolgversprechend sind Reformvorschläge wie eine Verhältniswahl?
Bierling: Das ist grundsätzlich möglich, weil die Verfassung nicht vorschreibt, wie die einzelnen Bundesstaaten ihre Wahlmännerstimmen verteilen. Aber der Bundesstaat, der dies als erster einführt, würde die Position der ihn dominierenden Partei schwächen, es sei denn, alle anderen Bundesstaaten führen es gleichzeitig ein – was nicht passieren wird. Generell scheint das amerikanische Wahlsystem nicht wirklich reformierbar zu sein, weil solche Verfassungs- und Gesetzesänderungen im Kongress keine Mehrheit haben. Im Moment profitieren die Republikaner von dem System, aber es könnte genauso gut den Demokraten zugutekommen. Reformen können nur durch Gerichtsurteile und Referenden auf der Ebene der einzelnen Bundesstaaten erreicht werden.
WELT: Kann sich das Land jemals von dieser Polarisierung erholen? Besteht die Chance einer „Wiedervereinigung“ der Staaten?
Bierling: Ich glaube, die Chancen sind gut. Wenn Trump die Wahl verliert, wäre das für die Republikaner eine dramatische Entwicklung. Sie haben schon die Halbzeitwahlen 2018 verloren, dann die Präsidentschaftswahlen 2020, dann die Halbzeitwahlen 2022. Wenn sie erneut verlieren, ist Trump wahrscheinlich Geschichte und die Partei muss sich neu aufstellen. Wir sehen auch eine gewisse Annäherung der Parteien bei einigen Themen, die die Nation gespalten haben – etwa bei der Abtreibung. Als der Supreme Court das bundesweit garantierte Abtreibungsrecht kippte und den Bundesstaaten zuwies, sprachen sich auch viele republikanische Frauen gegen diesen Schritt aus. Und plötzlich ruderte Trump zurück. Es gibt also einen Trend in die Mitte. Die größte Hoffnung liegt aber im demografischen Wandel der USA.
WELT: Wie kommts?
Bierling: Die parteipolitische Spaltung war ein Projekt der weißen intellektuellen Eliten, weil sie die beste Möglichkeit war, ihre überwiegend weißen Wähler zu mobilisieren – auf beiden Seiten. Aber Minderheiten, insbesondere Hispanics und asiatische Amerikaner, werden demografisch eine immer größere Rolle spielen. Diese Gruppen haben im Allgemeinen andere Anliegen als die Eliten. Sie wollen einen guten Job, eine sichere Lebenssituation und eine Familie gründen. Für sie sind diese ideologischen Debatten, ob von rechts oder von links, weit entfernt. Um solche Gruppen anzusprechen, müssen die Parteien praktische, realistische Lösungen anbieten und überparteilicher denken.
Lara Jaekel ist Redakteurin im Ressort Außenpolitik. Für WELT berichtet sie unter anderem über die US-Präsidentschaftswahl 2024.
Die Wahl des Jahres bei WELT: Alle Inhalte der Redaktion finden Sie in unserem Spezialthema auf US-Wahl 2024. Wie berichten wir? Hier präsentieren wir unsere US-Experten und Wahlformate vor.