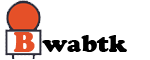Männer denken oft an das Römische Reich – manche ein paar Mal im Jahr, andere einmal im Monat oder jede Woche; und viele sogar jeden Tag. Diese Nachricht ging im vergangenen Herbst durch die Medienportale, ausgelöst durch eine Aktion auf Tiktok, bei der Frauen ihre Partner nach ihrer Beziehung zum antiken Rom befragten. Ergebnis: Während sich die weibliche Bevölkerung im Allgemeinen einen Dreck um das Imperium schert, ist es für die Mehrheit der männlichen Bevölkerung ein Dauerthema. Und unter denen, die an Cäsaren, Legionäre, Festungen und Gladiatoren denken, sind die Jüngeren eindeutig in der Mehrheit.
Aber warum? Die Kommentatoren, die versuchten, das schnell vorbeiziehende, heiße Thema am Ende zu packen, waren sich mehr oder weniger einig, dass die Rom-Sucht etwas mit Männlichkeitsidealen und jugendlichen Vorstellungen von Macht und Stärke zu tun haben könnte. Aber das erklärt nicht die Breite des Phänomens. Schließlich findet die römische Welt auch unter erfahrenen Männern und alten Leuten ihre Anhänger, und bei dieser Klientel spielen Bizepsfragen und Schwertlängen in der Regel keine Rolle mehr. Stattdessen tritt ein anderer Aspekt der Geschichte Roms in den Vordergrund.

Dieser Text stammt aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
Das Reich der Cäsaren ist untergegangen, und über die Ursachen seines Zusammenbruchs wird seit Jahrhunderten diskutiert, insbesondere in Europa und Amerika, den Ländern des modernen Westens, die nach dem Ende des Mittelalters aus der bankrotten Masse des Weströmischen Reiches hervorgegangen sind Alter. Aus dieser Perspektive ist Rom kein ermutigendes Vorbild, sondern ein entfernter Spiegel, in dem sich die Zukunftserwartungen und Zukunftsängste der Gegenwart schwach widerspiegeln.

Peter Heather und John Rapley sind zwei Mitglieder der Boomer-Generation, die aus Gründen der Jugend nicht mehr an Roms starke Männer denken müssen. Die Britin Heather veröffentlichte in den 2000er Jahren zwei Standardwerke zum Ende des Empire und zur Völkerwanderung, während die Kanadierin Rapley seit drei Jahrzehnten über globale Wirtschaftsgeschichte und den wirtschaftlichen Aufstieg von Schwellen- und Entwicklungsländern publiziert. Wenn beide zusammenkommen, um ein Buch zu schreiben, kann das nur bedeuten, dass sie ein gemeinsames Thema gefunden haben, und dieses Thema ist, wie der Titel „Falling Empires“ unverblümt sagt, der Untergang zweier Imperien.
Die These des Buches lässt sich wie folgt zusammenfassen: Wo Rom am Ende des vierten Jahrhunderts n. Chr. stand, steht heute der Westen: am Rande des Untergangs. Die einzige Frage für Heather und Rapley ist, wie dieser Herbst salonfähig gemacht und sein Erbe in „ein postkoloniales Erbe von wirklicher Größe“ umgewandelt werden kann, ein System, dessen „Gewinne potenziell kolossal sind“.

Bevor sie zu dieser Diagnose (und den damit verbundenen politischen Empfehlungen) kommen, müssen die beiden Autoren zunächst ihren Vergleich anstellen und dabei die krummen Linien der Weltgeschichte recht brutal begradigen. Der „Westen“ der Kolonialzeit und der darauf folgenden Globalisierung ist eine Mischung regionaler Mächte, die gegeneinander kämpfen und erbittert um die Vorherrschaft kämpfen; in Heather und Rapley hingegen erscheint es als geschlossener imperialistischer Block. Die heutige Vorherrschaft der USA wurde in zwei blutigen Weltkriegen auf europäischem und asiatischem Boden erkämpft; Für die Autoren von Falling Empires ist seine Entstehung kaum eine Fußnote wert.
Und wenn wir von der Weltmacht Rom sprechen, wird das gleichzeitig mächtige China der Han-Kaiser konsequent ignoriert. Stattdessen setzen die beiden Wissenschaftler das heutige China mit dem damals entstehenden persischen Sassanidenreich gleich, obwohl es nur an der römischen Ostgrenze kratzte, während der chinesische Wirtschaftsboom seit 1990 das amerikanische Imperium in seiner Kernfunktion als Weltmacht bedrohte wirtschaftliche Vormachtstellung.
Mit anderen Worten: Der Vergleich zwischen Rom und dem industrialisierten Westen, den Heather und Rapley ziehen, ist historisch schwach. Streng genommen basiert es auf einer einzigen strukturellen Überlegung: Wenn große Reiche gewaltsam expandieren, verlagern sie militärische und wirtschaftliche Kräfte vom Zentrum in die Peripherie und bauen Handelsnetzwerke über ihre Grenzen hinaus auf.

Auf diese Weise ließ Rom seine spanischen, gallischen, pannonischen und syrischen Provinzen aufblühen, während es die barbarischen Eliten jenseits von Rhein und Donau mit Luxusgütern versorgte und sie gleichzeitig dazu ausbildete, als Hilfstruppen in seinen Armeen zu kämpfen. Als die Barbaren mit dem Einmarsch der Hunnen von einem „exogenen Schock“ getroffen wurden, überquerten sie massenhaft die Grenzflüsse und zerrissen auf ihrer Wanderung das Staatsgefüge im westlichen Teil des Reiches.
Die Peripherie blüht, das Zentrum stagniert
Etwas Ähnliches geschah, so argumentieren Heather und Rapley, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als Nordamerika und Westeuropa, die bis dahin den größten Teil des Weltreichtums produziert und verbraucht hatten, ihre Industriekapazitäten in die aufstrebenden Volkswirtschaften Mittel- und Südeuropas auslagerten Amerika und Südostasien – nach Mexiko, Brasilien, Indien, Thailand, Taiwan, Südkorea usw. Die globale Peripherie begann zu prosperieren, während das Zentrum stagnierte; Die Produktivkraft des Westens nahm ab, die des Südens und Ostens wuchs. Aber all dies geschah auf unblutige, nicht-invasive, rein wirtschaftliche Weise. Aber das Ergebnis, so unsere beiden Historiker, könnte mittelfristig für das Weströmische Reich dasselbe sein: Entnationalisierung, Verarmung, Bevölkerungsrückgang, soziale Zerrüttung und kultureller Niedergang.

Aber wo ist in diesem Szenario der „exogene Schock“, der die römische Zivilisation zerstörte? Heather und Rapley bieten mehrere Kandidaten an: die Finanzkrise 2007/08, den Aufstieg Chinas, die Coronavirus-Pandemie, den russischen Krieg gegen die Ukraine. Schon die große Auswahl zeigt, wie wenig durchdacht sie sind. Selbst wenn man alle Faktoren zusammenzählt, kommt es nicht zu einem Schockmoment, das mit der Hunneninvasion vergleichbar wäre. Die Invasion aus der Steppe beeinträchtigte die militärische Substanz des Römischen Reiches, doch die Wirtschaftsmacht des Westens – zu der die Autoren plötzlich auch Japan zählen – ist im schlimmsten Fall beschädigt und ein Zusammenbruch ist nicht in Sicht.
Weil der Vergleich zwischen Rom und „uns“ an diesem entscheidenden Punkt fehlerhaft ist, ist auch seine argumentative Umsetzung in wesentlichen Punkten falsch. Zum Beispiel mit den Folgen der Migration, die nicht wie die Römer von der Peripherie, sondern aus den wirtschaftlich abgehängten Zonen der Globalisierung kommt und deren Konfliktpotenzial im Zeitalter des religiösen Fundamentalismus noch nicht einmal thematisiert wird. Oder mit der neuen Weltmacht China, die Heather und Rapley kontrafaktisch als militärischer Riese erscheint – die Amerikaner haben elf Flugzeugträger, die Chinesen zwei –, während die Atommacht Russland konsequent verharmlost wird.
Letztlich sticht trotz aller strukturellen Gemeinsamkeiten im Detail immer wieder der grundsätzliche Unterschied zwischen Rom und der Moderne hervor. Damals ging es um Land und Sklaven, heute geht es um Profite und Arbeitsplätze. Produktivkräfte können gesteigert werden, Landbesitz jedoch nicht. Das Römische Reich hatte bereits im zweiten Jahrhundert n. Chr. die Grenzen seines Wachstums erreicht und die Weltwirtschaft expandiert weiter.
Verarmung, Alterung, überlastete Sozialsysteme
Doch wahr ist, dass die Bevölkerung der westlichen Industrieländer immer älter wird, dass die Verarmung der Unterschichten zunimmt und dass Regierungen zunehmend an der Aufgabe scheitern, die Kosten für Sozialsysteme, Infrastruktur, ökologischen Wandel und eine funktionierende Verwaltung zu finanzieren der Staatshaushalt, während der Reichtum des oberen Zehntels der Gesellschaft unaufhaltsam wächst. In solchen Krisen denken nicht nur die Abonnenten des History Channel an das antike Rom, sondern auch Wissenschaftler wie Peter Heather und John Rapley werden ermutigt, ihr Wissen über die Antike in ein Werkzeug für Vorhersagen über die Zukunft zu verwandeln. Man muss einfach realistisch sein, wie weit man damit kommen kann. Das Buch von Heather und Rapley zeigt: nicht sehr weit.
Am Ende ihrer Studie stellen die Autoren einige Vorschläge vor, die jeder sozial denkende Finanzpolitiker unterzeichnen kann: Erhöhung des Rentenalters, kontrollierte Einwanderung, Investitionen in Bildung, Besteuerung großer Vermögen, verstärkte internationale Zusammenarbeit. Das klingt alles vernünftig und machbar. Aber um an diesen Punkt zu gelangen, muss man nicht an Römer, Goten und Vandalen denken. Es genügt ein nüchterner Blick auf die Gegenwart. Vergessen Sie die barbarischen Stürme! Lass Rom in Frieden ruhen.
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/rom-und-der-westen-peter-heathers-stuerzende-imperien-110036591.html