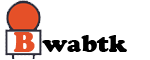taz: Herr Schneider, Sie sind in der Kampagne „LapCoffeeSchiße“ aktiv, die sich gegen eine neue Hype-Kette richtet, die To-Go-Angebote zu günstigen Preisen bewirbt. Wissen Sie, ob der Kaffee bei LAP wirklich so schlecht ist?
Mario Schneider (fiktiver Name): Nein, wirklich keine Ahnung. Unser Kritikpunkt an LAP ist nicht, dass der Kaffee scheiße schmeckt.
taz: Letztes Wochenende wurden alle LAP-Filialen mit Farbe beschmiert. Eine Aktion Ihrer Gruppe?
Schneider: Wir halten es für äußerst spekulativ, wie selbstverständlich die Farbstory mittlerweile in den Medien unserer Kampagne zugeschrieben wird. Meines Wissens gibt es keinen nachgewiesenen Zusammenhang.
taz: LAP-Gründer Ralph Hage zeigte sich nach der Farbaktion gesprächsbereit, dennoch ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Ihre Fraktion antwortete in einem offenen Brief mit einer Reihe von Forderungen: Hage solle unter anderem 80 Prozent seines Vermögens an Gewerkschaften spenden und alle Geschäfte schließen, in denen sich Anwohner aus der Nachbarschaft dagegen aussprechen.
Schneider: Ja. Hage arbeitete zuvor bei Red Bull und Delivery Hero. Beide Unternehmen sind für ihre Gewerkschaftsbekämpfung bekannt. Deshalb finden wir es nur fair, dass Hage sein Geld dazu verwendet, die Kämpfe der Mitarbeiter zu unterstützen. Und was die Schließung der Filialen betrifft: Es ist Teil der Imagekampagne von LAP, angeblich nur dorthin zu gehen, wo die Filialen gesucht werden. Also nehmen wir Hage einfach beim Wort.
taz: Erwarten Sie nicht wirklich, dass Hage darauf reagiert?
Schneider: Wir haben auf das Gesprächsangebot reagiert. Wir sind bereit, aber wir haben Voraussetzungen. Ehrlich gesagt finden wir Hage ein bisschen verrückt. Er hat das Liefer-Start-up Yababa bereits in die Wand getrieben. Er scheint extrem nervös zu sein. LAP ist investorenorientiert und Investoren wollen Renditen. Finanziert wird LAP von befreundeten Investoren wie HV Capital, die ihr Geld auch in Kriegsdrohnen investieren. Ihnen ist Ralph Hage egal, nur die Rendite zählt. Sie sind schnell weg, wenn es nicht gut läuft. Natürlich kann Kritik sehr gefährlich sein.
taz: Hage hat im BZ Es wurde auch gemunkelt, dass Ihre Kampagne aus der Kaffeeszene stammt. Ist das richtig?
Schneider: Die Aussage ist wirklich äußerst zweifelhaft. Wir glauben, dass dies ein Versuch ist, die Kritik an LAP in eine Kritik an der Preisgestaltung umzuwandeln. Das auch Spiegel schreibt von einem „Kampf um billigen Kaffee“. LAP erweckt den Anschein, als würden sie wegen ihrer niedrigen Preise angegriffen. Aber die Kaffeepreise sind nicht das eigentliche Problem. Uns beschäftigt die politische Bedeutung von LAP.
taz: Welches wäre?
Schneider: Hage gab kürzlich ein ausführliches Interview, das auf YouTube zu finden ist. Darin sagt er ganz klar, was die Vision ist. LAP will der Red Bull der Kaffeebranche werden. In den nächsten Jahren sollen 100 Filialen eröffnet werden. Aber das sollte nur der Anfang sein. Sie wollen mit dem Hype, den sie selbst zu erzeugen versuchen, in das Online-Geschäft einsteigen. Das Motto lautet: „Monetarisieren von bestehenden Kunden“ – also der „Community“, die sie rund um die Marke bilden wollen, andere Dinge zu verkaufen.
taz: Ist das nicht ganz normaler Kapitalismus? Was unterscheidet LAP von anderen Kaffeeketten wie Starbucks?
Schneider: LAP geht viel aggressiver in die Quartiere und mietet Flächen an, die sich andere Menschen nicht mehr leisten können. Dadurch setzt LAP bei Gewerbemieten völlig andere Maßstäbe. Die Folge ist, dass die Schneiderei oder Kita nebenan verdrängt wird. Starbucks gibt es an Bahnhöfen oder in Touristen-Hotspots wie der Friedrichstraße. Doch LAP will diesen Hype befeuern. Das ist natürlich auch fiktiv, wie das Radioformat Trasherchiert kürzlich verriet: Sie engagieren eigene Influencer, um Hype zu erzeugen. Dafür braucht es einen schicken Laden in der Kastanienallee.
taz: Im BZ Ihre Kampagne wird nun als gewalttätiger linker Mob dargestellt, der Menschen mit Ideen aus der Stadt vertreibt.
Schneider: (lacht) Ja, das stimmt. Autolofts werden als eine der Geschäftsideen genannt, die Menschen wie uns aus Berlin vertrieben haben sollen: Das bedeutet, dass heute nicht mehr viele Menschen ihren Porsche mit dem Aufzug auf dem Balkon parken können. Wir glauben, dass Luxuswohnungen mit Autoaufzügen nicht das Wichtigste für Berlin sind. Viel wichtiger seien bezahlbare Mieten, die Armutsbekämpfung und die Vergesellschaftung der Immobilienunternehmen. Wir wollen eine solidarische Stadt, in der es für alle fair ist – von den Arbeitern in den Kaffeehäusern bis zu den Produzenten in Mittel- und Südamerika, von denen die meisten kapitalismus- und geschäftsmodellkritisch sind wie von Hage.