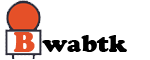Immer mehr Menschen in Deutschland unterziehen sich einer Geschlechtsumwandlung. Der Prozess ist langwierig und für die Patienten oft ein großer Leidensdruck. Auch die Feindseligkeit gegenüber den Betroffenen nehme zu, sagt eine Expertin und betont: „Eine Geschlechtsumwandlung ist keine Modeerscheinung.“
Im falschen Körper geboren – immer mehr Menschen entscheiden sich für eine Geschlechtsumwandlung. Mit dem im Herbst in Kraft tretenden neuen Selbstbestimmungsgesetz rechnen Zentren, die solche Operationen durchführen, mit einer weiter steigenden Nachfrage. Was steckt hinter dieser Entwicklung – und wie funktioniert sie medizinisch?
Menschen, die trans* sind, identifizieren sich nicht mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Manche verwenden auch den Begriff Transgender. Manche haben schon seit ihrer Kindheit das Gefühl, im „falschen Körper“ zu sein, andere wiederum stellen im Laufe ihres Lebens fest, dass sie sich zum Beispiel weder männlich noch weiblich fühlen. Dabei ist es unerheblich, ob medizinische Maßnahmen wie Hormonbehandlungen oder Geschlechtsumwandlungen durchgeführt werden. Trans* fungiert hier als Überbegriff, der weitere Begriffe wie „transident“, „transgender“ oder „transsexuell“ einschließt. Das Asterisk dient dabei als Platzhalter für die verschiedenen Endungen. Trans*-Menschen beschreiben sich selbst auf ganz unterschiedliche Weise. Manche bezeichnen sich explizit als Trans*-Frau oder Trans*-Mann, andere weisen keine eindeutige Geschlechtsidentität zu.
Nur etwa eine Handvoll Kliniken bundesweit sind in der Lage, alle notwendigen Operationsschritte durchzuführen. Eine davon ist das Agaplesion Markus-Krankenhaus in Frankfurt, das einzige Zentrum dieser Art in Hessen. Prof. Ulrich Rieger, Chefarzt der Plastischen Chirurgie, und Dr. Saskia Morgenstern, Leiterin der Abteilung Rekonstruktive Urologie, führen seit Jahren die gesamte Bandbreite der Transgender-Operationen durch. Am Uniklinikum Frankfurt gründete der Endokrinologe Prof. Jörg Bojunga die Arbeitsgemeinschaft Transgendermedizin. Sie alle berichten von einem hohen Leidensdruck der Betroffenen. Die Vorstellung, Geschlechtsumwandlung sei eine Modeerscheinung, hält Bojunga für absurd: „Keiner macht das, weil er eine Fernsehsendung gesehen hat.“
Zunahme der Zahlen
Laut Statistischem Bundesamt gab es im Jahr 2021 bundesweit 2.598 geschlechtsangleichende Operationen. Im Jahr 2007 waren es erst 419. Die Zahl steigt von Jahr zu Jahr deutlich an.
„Ja, es gibt einen Anstieg, aber er ist nicht explosionsartig“, stellt Morgenstern klar. Zumal jeder Eingriff einzeln gezählt wird, auch wenn eine Person mehrfach betroffen ist. Ein und derselbe Transmann könne zum Beispiel mit sieben „Frau-zu-Mann“-Operationen in die Statistik eingehen. „Nicht alle Transgender wollen so umfangreiche Operationen“, sagt Rieger. Bei nicht wenigen bleibe es bei einem einzigen, relativ kleinen Eingriff, etwa an der Brust. Bojungas Erfahrung zeigt, dass vielen eine Hormontherapie genügt, um ihre Lebensqualität zu verbessern.
Oft mit Feindseligkeit konfrontiert
Der Kampf um Anerkennung beginnt mit dem Kampf um Begriffe: Medizinisch korrekt heißt das „Geschlechtsinkongruenz“ – also der Zustand, bei dem die wahrgenommene Geschlechtsidentität nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. „Geschlechtsdysphorie“ nennt man dies, wenn darunter Leiden entstehen.
Bojungas erster Kontakt mit einer transsexuellen Person liegt rund 20 Jahre zurück. „Vor mir stand ein Mann Mitte 50, der sein Leben lang Gewalt ausgesetzt war und völlig verzweifelt war. Er sagte: Entweder ich suche mir Hilfe oder ich bringe mich um.“
Welchen Anfeindungen die Menschen ausgesetzt sind, zeigte ein Vorfall Anfang des Jahres an der Uniklinik. Auf der Toilette der Ambulanz hatte jemand eine Nachricht mit verächtlichen Beleidigungen und Gewaltandrohungen gegen Trans- und Queer-Personen hinterlassen. Bojunga berichtet aus seinen Gesprächen, dass die Anfeindungen zugenommen hätten und die Hemmungen in den sozialen Medien sinken.
Der Weg ist lang
So wie im Markuskrankenhaus niemand klingeln und sich spontan operieren lassen kann, bekommt auch im Uniklinikum niemand beim ersten Termin ein Rezept für eine Hormonbehandlung. Neben Endokrinologen müssen auch Psychologen zustimmen, dass eine solche Therapie nötig ist. Manchmal müssen Hormone lebenslang eingenommen werden. Sie hemmen oder fördern das Brustwachstum, heben oder senken die Stimme, stimulieren oder verhindern den Bartwuchs. Manchmal aber ist die Hormontherapie nur der erste Schritt auf einem Weg, der viel weiter geht.
Die mit Abstand häufigste Operation bei beiden Geschlechtern betrifft die Brüste. Viele Transmänner lassen sich die Brüste operativ entfernen, viele Transfrauen lassen sie mit Implantaten vergrößern. „Sehr oft bleibt es bei dieser einen Operation“, sagt Rieger. Den meisten Transmenschen geht es vor allem darum, wie sie auf andere, fremde Menschen wirken. Einer Studie zufolge haben 65 Prozent von 6.800 Transmenschen eine Hormontherapie gemacht. Davon entschieden sich 75 Prozent der Transfrauen und 84 Prozent der Transmänner für mindestens eine Operation.
Wie wird ein Mann zur Frau?
Entscheidet sich ein Mensch, der mit einem männlichen Körper geboren wurde, für eine Operation zur Geschlechtsumwandlung, läuft diese – vereinfacht ausgedrückt – so ab: Die Hoden werden entfernt. Aus dem Hodensack werden die Schamlippen geformt. In der Bauchhöhle entsteht ein Hohlraum. Der Penis wird ausgehöhlt. Die Haut des Penis wird nach innen gestülpt – daraus entsteht die Vulva. Aus der Eichel wird die Klitoris geformt.
Die Nerven bleiben größtenteils intakt, wie Morgenstern erklärt. Eine Studie aus Kanada aus dem Jahr 2017 ergab, dass über 80 Prozent der befragten Transfrauen einen Orgasmus erleben konnten. Doch das hat seinen Preis: Nach der Entladung muss die „Neovagina“ ein Leben lang mehrmals täglich mit einem Gerät gedehnt werden, um ein erneutes Verschließen zu verhindern. Und umgekehrt?
Soll aus einer Frau körperlich ein Mann werden, ist die Operation deutlich aufwändiger. Der Haupteingriff dauert rund acht Stunden, davor und danach sind diverse weitere Operationen nötig, wie Rieger erklärt. Für die Rekonstruktion eines Penis – im Fachjargon heißt das Phalloplastik – entfernen die Ärzte dem Patienten Haut vom Unterarm und Gewebe vom Oberschenkel. Eine Erektion ist auf natürlichem Wege nicht möglich, es muss ein Implantat eingesetzt werden, das der Transmann vor dem Geschlechtsverkehr aufpumpt.
Risiko von Komplikationen
Das Penisimplantat ist ein Fremdkörper und wird vom Körper unterschiedlich erfolgreich angenommen, wie Morgenstern erklärt. Selbst bei Erfolg muss es nach einigen Jahren zwangsläufig ausgetauscht werden. Ein weiteres Problem ist, dass die Harnröhre verlängert werden muss. Dafür werden unter anderem aufgerollte Schamlippen verwendet. Die Übergänge sind eine Risikozone für Komplikationen.
Das Einsetzen der neuen Hoden ist vergleichsweise unproblematisch. Optisch sei der neue Penis weit davon entfernt, ein natürliches Exemplar zu imitieren, sagt der Chirurg, auch wenn die Eichel ein Jahr nach der Erstoperation neu geformt wird, um den Neopenis natürlicher erscheinen zu lassen. Anschließend stehen bis zu 20 Nachuntersuchungen an. Fast alle Transmänner, die sich dieser Operation unterzogen haben, sind orgasmusfähig.
Muss das sein?
Ist die Operation im Einzelfall notwendig, sinnvoll und gerechtfertigt? „Ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss“, sagt Rieger. Bevor Patientinnen zu ihm und Morgenstern kommen, müssen sie psychologische und psychiatrische Gutachten vorlegen, mindestens ein halbes Jahr eine Hormontherapie hinter sich haben und sicherstellen, dass ihre Krankenkasse die Kosten übernimmt. Eine OP-Serie mit sechs Eingriffen kostet laut Rieger mehrere zehntausend Euro. Dass Menschen, die sich im Markus-Krankenhaus einer Geschlechtsumwandlung unterzogen haben, den Eingriff im Nachhinein bereuen, komme „äußerst selten“ vor, sagt Morgenstern. „Auch wenn es viele Komplikationen gab, ist die Zufriedenheit danach sehr hoch – weil es für die Menschen einen so großen Unterschied macht.“
Eine Metaanalyse von 27 Studien mit Daten von insgesamt 7.928 Transgender-Patienten ergab, dass nur ein Prozent die Geschlechtsumwandlung bereut hat. „Die Patienten wissen genau, was auf sie zukommt“, sagt Rieger. „Und sie sind bereit, diesen Weg zu gehen.“
Wünsche kommen immer früher
Was sich mit der Zunahme der Fälle geändert hat, ist das Klientel: „Die Patienten werden immer jünger“, sagt Bojunga. Was für Kritiker wie eine negative Entwicklung klingt, sei in Wahrheit eine positive, sagt der Arzt: „Sie haben eine kürzere Leidensgeschichte.“
Eine weitere Entwicklung: Früher besuchten mehr Transfrauen – also biologische Männer mit weiblicher Identität – die Ambulanz, heute kämen mehr Frauen, die als Mann leben wollen. Ein „ungelöstes Problem“ sei für ihn die Frage, wie mit sehr jungen Betroffenen umgegangen werden solle. Sogenannte Pubertätsblocker, die die Entwicklung zum Mann oder zur Frau verzögern, seien umstritten. Ein Kritikpunkt sei, dass sie eine Art Vorentscheidung für einen sehr jungen Menschen seien.
Selbstbestimmungsrecht
Während es bereits seit 2018 eine ärztliche Leitlinie zur Diagnostik, Beratung und Behandlung gibt, gibt es in der Chirurgie große Unterschiede zwischen den einzelnen Fachzentren. In Arbeit ist nun aber auch eine Leitlinie für geschlechtsangleichende chirurgische Eingriffe.
Die neue Arbeitsgruppe Transgender Medicine will Richtlinien für den Prozess der Geschlechtsumwandlung entwickeln und Forschungsprojekte koordinieren. Die Zahl wissenschaftlicher Studien hält sich bislang in Grenzen. Da das ganze Thema relativ neu sei, fehle es an Langzeitdaten, sagt Bojunga – etwa welche Auswirkungen eine jahrzehntelange Hormoneinnahme hat und warum Transfrauen eine höhere Selbstmordrate haben.
Im November soll ein neues „Gesetz zur Selbstbestimmung bei der Geschlechtseintragung“ in Kraft treten, das der Bundestag im April 2024 beschlossen hatte. Es ersetzt das Transsexuellengesetz aus dem Jahr 1981, das das Bundesverfassungsgericht in mehreren Entscheidungen für verfassungswidrig erklärt hatte. Das neue Gesetz soll Trans-, Inter- und nichtbinären Menschen die Änderung ihrer Geschlechtseintragung und Vornamen erleichtern. Das Gesetz werde allerdings „keine Regelungen zu geschlechtsangleichenden medizinischen Maßnahmen treffen“, wie das Bundesgesundheitsministerium betont.