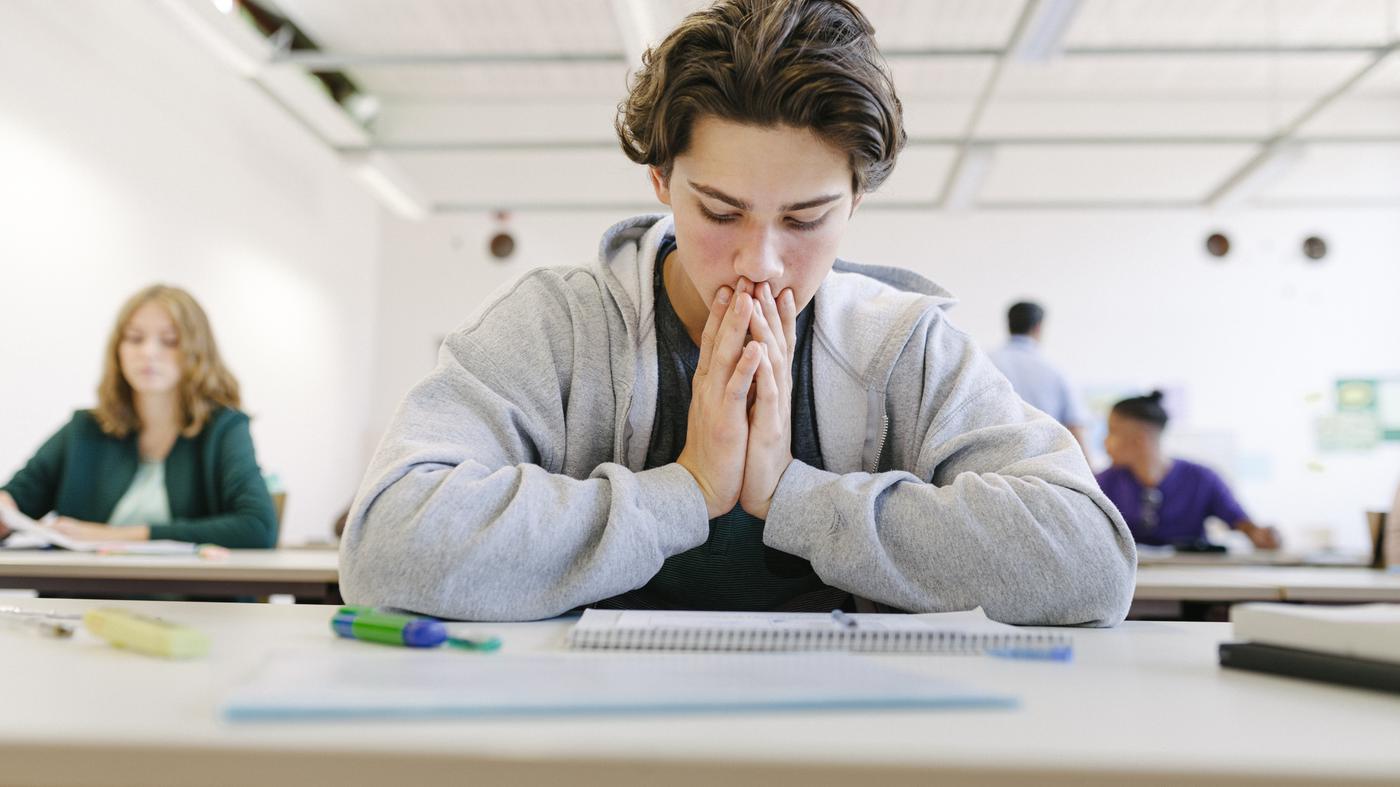Letzte Woche zeichnete sich ab, dass die Folgen des „Bildungstrends“ in diesem Jahr dramatisch sein würden. Insider berichteten plötzlich, dass die Kultusministerkonferenz (BMK) die Veröffentlichung des Bildungstrends des unabhängigen Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) verschieben wollte: ohne Angabe von Gründen und ohne neuen Termin.
Anstatt zu erklären, was vor sich ging, wurde der Klub der Bildungsminister geschlossen. Keine Reaktion auf Presseanfragen, dafür hektische Meetings. Doch dann mussten Simone Oldenburg, die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz und Bildungsministerin von Mecklenburg-Vorpommern, und Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) am Donnerstagnachmittag einen beispiellosen Einbruch der Leistungen deutscher Neuntklässler in Mathematik und Naturwissenschaften verkünden.
Massive Probleme in Mathematik und Naturwissenschaften
Der IQB-Bildungstrend für 2024 misst 24 Kompetenzpunkte weniger in Mathematik, Biologie, Chemie und Physik. Das bedeutet, dass die heutigen Neuntklässler im Vergleich zur letzten Befragung im Jahr 2018 im Schnitt etwa ein Jahr im Rückstand sind – das heißt, sie sind massiv schlechter darin, mathematische Probleme zu lösen und naturwissenschaftliche Fragestellungen zu verstehen, anzuwenden und zu bewerten.
Noch dramatischer: Rund ein Viertel der Schüler (24 Prozent) erreicht nicht einmal die Mindeststandards für den Mittleren Schulabschluss (MSA) in Mathematik, wie sie das IQB im Auftrag der Kultusminister definiert. In der Chemie fällt jeder Vierte durch (25 Prozent), in der Physik fällt jeder Sechste durch (16 Prozent). Erst ab zehn Prozent sieht es in der Biologie besser aus. Umgekehrt können nur 42 Prozent den sogenannten Standardstandard für den MSA in Mathematik erreichen – also das, was jeder mindestens können sollte, um einen Hauptschulabschluss zu erhalten. In der Chemie sind es 45 Prozent, in der Physik 57 Prozent und in der Biologie 59 Prozent.
Das IQB spricht von einem „bundesweiten Abwärtstrend“, und tatsächlich ist der Anteil der Studierenden, die die MSA-Mindeststandards nicht erfüllen, in allen Bundesländern gestiegen – in Mathematik um durchschnittlich neun Prozentpunkte.
Vorne liegen Bayern, Sachsen und Schleswig-Holstein
Und der Rückgang hat sich beschleunigt: Während die Kompetenzwerte zwischen 2012 und 2018 weitgehend stabil blieben, markieren die aktuellen Einbrüche einen bildungspolitischen Wendepunkt. So wie letztes Jahr beim IQB-Bildungstrend Deutsch, der einen ähnlichen Absturz beschrieb. Damals entwickelten sich lediglich die Englischkenntnisse gegen den Trend und überraschend positiv.
Die Neuntklässler waren während des ersten Lockdowns in der fünften Klasse. Mit den Nachwirkungen kämpfen sie offenbar noch heute.
IQB-Direktor Petra Stanat
Auch hier zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern: Bayern, Sachsen und Schleswig-Holstein schneiden bei den Leistungen in Mathematik noch vergleichsweise gut ab, während das IQB aus Bremen, Hessen und Nordrhein-Westfalen „durchwegs besonders schwache Ergebnisse“ vermeldet. Auch in den Naturwissenschaften liegen Bayern, Sachsen sowie Teile von Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Thüringen vorne. Am anderen Ende der Skala: Berlin – und wieder Bremen, Hessen und Nordrhein-Westfalen.
Rückstand aufgrund der Pandemie
Die alles entscheidende Frage ist: Was ist dort passiert? IQB-Direktorin Petra Stanat sagt: vor allem die Corona-Pandemie. „Die jetzt getesteten Neuntklässler waren während des ersten Lockdowns in der fünften Klasse. Sie haben offenbar auch heute noch mit den Nachwirkungen zu kämpfen.“
Anhand der Antworten der Schülerinnen in der IQB-Begleitbefragung lässt sich erkennen, dass ihre psychische Gesundheit, insbesondere die der Mädchen, nicht wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht hat. „Seit der Pandemie jagt eine Krise die nächste, und das hat ihre Spuren hinterlassen.“ Und das nicht nur in Deutschland: Im vergangenen Jahr zeigte die internationale PISA-Studie in vielen Ländern starke Einbußen bei den Schülerleistungen.
Auch deutsche Studierende hinken hinterher
Wie sieht es mit dem Thema Einwanderung aus, das in Bildungsdebatten oft reflexartig thematisiert wird, sobald es mit den Leistungen bergab geht? Die Realität ist viel differenzierter. Einerseits: Der Anteil der Schüler aus Einwandererfamilien ist zwischen 2018 und 2024 bundesweit um sieben Prozentpunkte auf 40 Prozent geklettert, was genau dem Anstieg zwischen 2012 und 2018 entspricht. Nur kam der Anstieg dieses Mal fast ausschließlich von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen.
Andererseits schnitten Einwandererkinder in absoluten Zahlen zwar erneut deutlich schwächer ab, doch der Leistungsrückgang in Mathematik und Naturwissenschaften betraf dieses Mal die gesamte Schülerschaft und war damit weitgehend unabhängig von der sozialen Herkunft und dem Migrationshintergrund. „Wir haben auch berechnet, wie die Ergebnisse aussehen würden, wenn sich die Studierendenschaft seit 2018 nicht verändert hätte“, sagt Stanat. „Das Ergebnis: Der Abwärtstrend bliebe bestehen. Lediglich die Unterschiede zwischen den Bundesländern würden kleiner – abhängig vom Anteil junger Menschen mit Migrationshintergrund und dem durchschnittlichen sozialen Status ihrer Familien.“
Abwärtstrend seit zehn Jahren
Für Schulen und Bildungsminister sind die Ergebnisse schwer zu verdauen – sie verlängern und beschleunigen nun einen Abwärtstrend, der seit mehr als einem Jahrzehnt anhält. Für Gefühle der Ohnmacht und Resignation gebe es aber keinen Grund, sagt IQB-Direktorin Petra Stanat. „Die jeweilige Bildungspolitik macht einen Unterschied. Das sieht man in Hamburg, wo seit vielen Jahren eine konsequente Schulentwicklung betrieben wird, oder in Baden-Württemberg, das ebenfalls diesen Weg eingeschlagen hat. Und das spiegelt sich in den Ergebnissen wider.“ Erstmals liegt Baden-Württemberg in allen untersuchten Fächern wieder über dem Bundesdurchschnitt.
Diese Generation hat durch die Pandemie viel verloren – jetzt ist es unsere Aufgabe, ihnen mehr zurückzugeben, als sie verloren hat.
Bildungsminister Christine Streichert-Clivot (Saarland).
Nach dem ersten Schock scheinen sich die Bildungsminister erholt zu haben. Sie sagten die Verschiebung ab und zeigten sich in ihren ersten Erklärungen vor der Pressekonferenz kämpferisch.
„Kein Grund zum Rücktritt, sondern ein Auftrag zum Handeln“ – so beschreibt die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) den IQB-Bildungstrend. „Wir wissen, dass Präsenzunterricht funktioniert – und dass unsere Programme Wirkung zeigen“, sagt Streichert-Clivot, die auch die Bildungspolitik der SPD-regierten Länder koordiniert. „Diese Generation hat durch die Pandemie viel verloren – jetzt ist es unsere Aufgabe, ihnen mehr zurückzugeben, als sie verloren hat.“ Sie verweist auf Investitionen in die Unterrichtsqualität, die Lehrerfortbildung und gezielte Förderung sowie auf Programme wie QuaMath zur Weiterentwicklung des Mathematikunterrichts und StarS für den Übergang in die Grundschule.
Streichert-Clivots CDU-Kollegin, NRW-Bildungsministerin Dorothee Feller, nennt die Ergebnisse „unbefriedigend“ und weist angesichts der Leistung NRW darauf hin, dass die Werte in allen Bundesländern „gesunken“ seien. Die Ursachen seien vielfältig – Pandemien, Kriege, Migration, soziale Medien – „was unseren Schulen allesamt viel abverlangt“.
Darauf hätten die Länder bereits reagiert, „unter anderem mit Maßnahmen zur datengestützten Qualitätsentwicklung und gezielter Förderung besonders belasteter Schulen.“ Das neue StartChances-Programm werde „einen entscheidenden Beitrag zu besseren Bildungschancen leisten“. Und: „Schulpolitik ist und bleibt ein Marathon, kein Sprint.“
Allerdings stimmt auch, dass die aktuellen Bildungsminister – oder ihre Vorgänger – jede Studie mit enttäuschenden Ergebnissen aus den letzten zehn Jahren kommentiert haben. Was jetzt nötig ist, ist mehr als das: eine schonungslose Auseinandersetzung mit den Gründen für einen Abwärtstrend in der Bildungspolitik, der schon lange vor Corona begann.