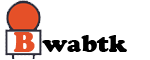E Es könnte einer der kürzesten politischen Umwälzungen in der Geschichte gewesen sein. Es dauerte nicht einmal eine halbe Woche, bis die vorsichtige Euphorie des Bundesparteitags in Halle in der Linkspartei verflogen war. Noch bevor die neu gewählten Vorsitzenden Ines Schwerdtner und Jan van Aken ihre großangelegte Haustürkampagne starten konnten, hatten namhafte Berliner Linke ihnen bereits die Türen vor der Nase zugeschlagen. Dass der Kreis um Ex-Kultursenator Klaus Lederer und Ex-Sozialsenatorin Elke Breitenbach auf den Tag genau ein Jahr nach Sahra Wagenknecht die Linke verlassen hat, ist nicht ohne eine gewisse Tragik.
Es waren Lederer, Breitenbach & Co, die jahrelang gegen Wagenknechts „Linkskonservatismus“ gekämpft hatten. Sie wollten vorausschauend nicht warten, bis es ihren damaligen nationalpopulistischen Parteikollegen und ihren Mitstreitern gelang, die Linke in eine Trümmerlandschaft zu verwandeln, um dann ein neues Parteiprojekt zu starten. Das bedeutet, dass der Reformflügel der Berliner Linken daran gescheitert ist, dass es auf Bundesebene bei manchen Menschen an Bewusstsein für die Notwendigkeit und anderen an Mut zur Trennung mangelte. Wagenknecht schaffte zum für sie besten Zeitpunkt endlich selbst die Pause. Angesichts des gefährlichen gesellschaftlichen Rechtsdrifts, den der BSW mit vorantreibt, macht es die Welt nicht gerade jetzt besser, die Waffen niederzulegen.
Der lange Kampf für eine Linke, die „wieder politik- und kreativitätsfähig“ werden muss, wie Lederer Anfang des Jahres in seinem Buch „Mit der Linken die Welt verändern“ schrieb, hat viele in seinem Lager zermürbt. Das liegt nicht zuletzt an der toxischen Diskussionskultur in der Partei. Der Streit um den richtigen Umgang mit dem Nahostkonflikt und dem linken Antisemitismus, der Anfang Oktober zum Eklat auf dem Berliner Landesparteitag führte, ist für einige nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.
Angesichts des starken Rechtsrucks in der Gesellschaft wird die Welt nicht besser, wenn man gerade jetzt die Waffen niederlegt
Dies wurde als „innerparteiliches Friedensabkommen“ bezeichnet. ndder frühere Neues Deutschlandauf dem anschließenden Bundesparteitag die Einigung über einen breiten Zustimmungsantrag. Tatsächlich handelte es sich lediglich um einen vorübergehenden Waffenstillstand. Denn das Problem der Linkspartei waren nie ihre Entscheidungen, sondern das Papier war die Geduld.
Trotzkistische Gruppen wurden toleriert
Dass sich die Linke „Antisemitismus aller Art“ entgegenstellen müsse, heißt es bereits in ihrem Grundsatzprogramm von 2011. Insbesondere die besondere Verantwortung Deutschlands aufgrund der beispiellosen Verbrechen an Juden im Nationalsozialismus „verpflichtet uns auch, für die Israels einzutreten.“ Existenzrecht.“ dort geht es weiter. Zugleich stehe die Partei „für eine friedliche Beilegung des Nahostkonflikts im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung“. Dennoch wurden in ihren Reihen stets (Minderheits-)Gruppen, insbesondere trotzkistischer Herkunft, geduldet, die völlig andere Vorstellungen vertreten.
Zu einem öffentlich sichtbaren Problem wurde dies nach dem Terrormassaker vom 7. Oktober 2023, das in diesen Kreisen als „Hamas-geführte Offensive gegen Israel“ verherrlicht wird, wie es der „Sozialismus von unten“-Aktivist Ramsis Kilani formuliert. Bis heute rechtfertigt die Linke in Berlin-Neukölln den Terror der Hamas: „Für revolutionäre Sozialisten hatten und haben die Palästinenser immer jedes Recht, sich mit allen notwendigen Mitteln gegen die von den Imperialisten unterstützte zionistische Siedlerkolonie zu verteidigen, die ihr Land besetzt.“ unterdrückt“, schrieb Kilani im Juni dieses Jahres in der Zeitschrift Internationaler Sozialismus.
Doch statt seinen Ausschluss zu fordern, solidarisierten sich rund 140 Teilnehmer des Bundesparteitags – darunter ein Bundestagsabgeordneter, ein Europaabgeordneter und mehrere Bundesvorstände – in einer schriftlichen Stellungnahme mit ihm, weil Kilani angeblich eingesetzt worden sei unfaire Mittel seien wegen seines „Bekenntnisses zur Palästina-Solidarität“ unter Beschuss geraten.
Nun soll in Berlin ein Ausschlussverfahren eingeleitet worden sein. Dies kommt jedoch oft zu spät. Wenn eine Partei auf dem Vormarsch ist, bringt der Erfolg auch diejenigen zusammen, die eigentlich nicht zusammengehören. Es ist viel einfacher, sich von einer Party im Niedergang zu verabschieden. Es scheint nichts mehr zu gewinnen und nicht mehr viel zu verlieren zu geben. Dadurch sinkt auch die Bereitschaft zur falschen Toleranz. Doch obwohl sie ihre tiefe Frustration verstehen, ist es fatal, wenn die falschen Leute gehen. Für die Verbliebenen wird es nun noch schwieriger werden, den Absturz der Partei in außerparlamentarische Vergessenheit zu verhindern.