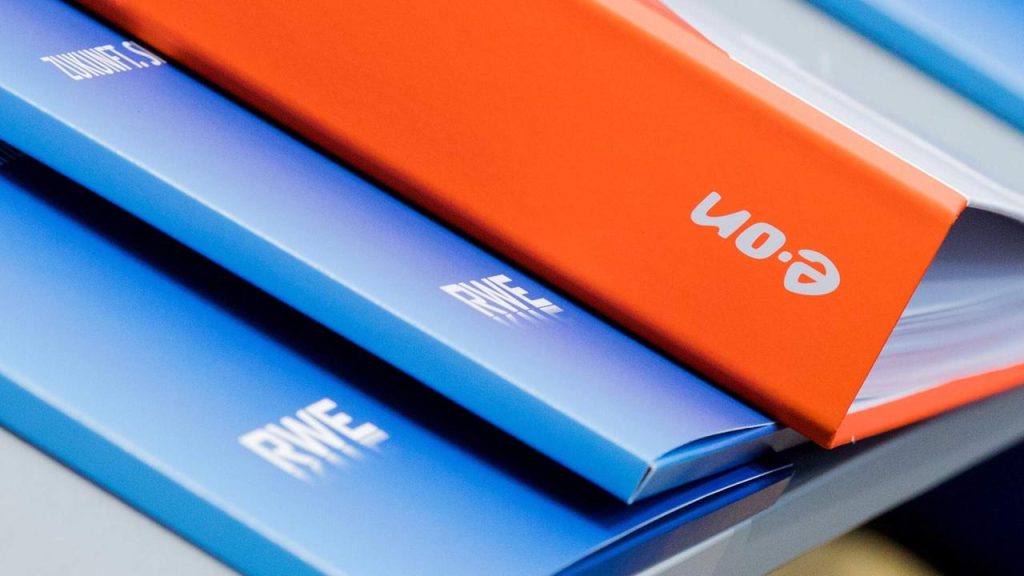Mehrere kommunale Versorgungsunternehmen sehen die Aufteilung des Energiegeschäfts zwischen RWE und E.On sehr kritisch – und beklagten sich. Der Europäische Gerichtshof lehnte die Bedenken ab.
Es war eine der größten Energie in Deutschland in den letzten Jahren: Ab 2018 hatten Energieunternehmen E.on und Rwe ihr Geschäft miteinander umverteilt. Der Wert des Deals: 40 Milliarden Euro. Der Grund für die Umstrukturierung des Geschäfts war die von der RWE -Tochter Innogy.
RWE übernahm das Geschäft der erneuerbaren Energien von E.on und Innogy, E.on, im Gegenzug die Netzwerke und das Endkundengeschäft von Innogy. Die Umstrukturierung des Geschäfts zwischen den beiden Unternehmen fand in insgesamt drei einzelnen Transaktionen statt. Die erste und zweite Transaktion wurde von der EU -Kommission in Brüssel, der Dritten aus dem Bundeskartellbüro, geprüft und genehmigt.
Der Kern des Rechtsstreits sind die Genehmigungen der EU -Kommission. Mehrere deutsche Stadtversorgungsunternehmen und kleinere Energieversorger, darunter der Energielieferant von Sachsenenergie, hatten die beiden Genehmigungen der EU -Kommission verklagt. Sie sagen: Die EU -Kommission hätte nicht jeden Schritt einzeln auf die Genehmigung überprüft haben, sondern die Fusion im Gesamtbild berücksichtigen sollen. Sie befürchten, dass die beiden großen Unternehmen aufgrund der Fusion zu viel Strom auf den Energiemarkt bekommen werden.
Stattwerke kritisierte negative Folgen
„Die Marktsteilung zwischen Rwe und E.on droht für den Wettbewerb und kleinere Anbieter“, sagte Claudius Rookosch, Sprecher von Sachsenenergie ARD Legal Redaktionsteam. Die Umverteilung des Geschäfts hat auch Konsequenzen für Verbraucher. Insbesondere bei Vergleichsportalen würden sie den Verbrauchern den Eindruck vermitteln, dass sie zwischen verschiedenen Stromanbietern wählen könnten. „Aber in Wahrheit gibt es Marken aus der E.ON -Gruppe hinter zahlreichen Angeboten – zum Beispiel Innogy oder Eprimo. Der Eindruck der Vielfalt ist täuscht. Es ist normalerweise eine und dieselbe Gruppe“, sagte Rookosch.
Bereits vor dem Europäischen Gericht (EKG) waren die kommunalen Versorgungsunternehmen mit ihren Beschwerden erfolglos. Das EKG hatte sich im Jahr 2023 entschieden: Die EU -Kommission hat den Deal zu dieser Zeit zu Recht genehmigt. Es war rechtlich in Ordnung, dass die EU -Kommission die einzelnen Transaktionen für sich selbst während der Genehmigung untersuchte. Weil es nach dem EKG keine einzige Fusion ist. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat diese Entscheidung nun ebenfalls bestätigt.
Die Richter in Luxemburg wiesen auch darauf hin, dass die kommunalen Versorgungsunternehmen nicht ausreichend nachgewiesen hatten, dass sie von dem Deal zwischen Rwe und E.On in ihrer Marktposition betroffen waren.
Rechtsstreit nicht abgeschlossen
Claudius Rokosch aus der Sachsenenergie war von dem EuGH -Urteil enttäuscht. Saxon Energy bedauert die Entscheidung des EuGH, hoffen aber dennoch auf eine effektive Marktüberwachung durch die Behörden.
Der Rechtsstreit wurde jedoch noch nicht abgeschlossen. Der EUJ entschied sich erstmals für die Klage gegen die erste Genehmigung der EU -Kommission. Gegen die zweite Genehmigung der Kommission stehen die Klagen des städtischen Versorgungsunternehmens im EuGHT noch an.
AZ. C-464/23 P ua