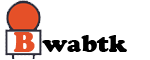Es war im hohen Sommer 1832, als Richard Wagner in Wien ein Konzert besuchte, das ihm in lebhafter Erinnerung bleiben sollte. Johann Strauss (Vater), dieser „Dämon des Wiener musikalischen Volksgeistes“, habe beim Publikum, das „wirklich mehr von seiner Musik als von den genossenen Getränken“ berauscht gewesen sei, ein „wahres Wonnegewieher“ ausgelöst, schrieb er Jahrzehnte später in seiner Autobiographie „Mein Leben“. Tatsächlich wurde in Wien wohl nie so ekstatisch gefeiert, so ausgelassen getanzt und musiziert wie in den Jahren nach dem Sieg über Napoleon, als sich die Menschen in einen Taumel der Vergnügungen stürzten, um wenigstens auf ein paar Stunden dem drückenden Alltag im reaktionärem Regime Metternichs zu entkommen. Johann Strauss wusste dieses Bedürfnis so geschickt zu bedienen wie später sein gleichnamiger Sohn, der zu einem der populärsten Musiker seiner Zeit wurde, gefeiert nicht nur in Wien, sondern bald schon in ganz Europa, in Russland und Amerika.
Dass die Melodien der Strauss-Familie auch heute noch in aller Welt gekannt und geliebt werden, ist sicher auch das Verdienst des Neujahrskonzertes der Wiener Philharmoniker, das Jahr für Jahr live aus dem Goldenen Saal für ein Millionenpublikum übertragen wird. Versteht sich, dass 2025 die Kompositionen von Johann Strauss (Sohn) den Schwerpunkt des Konzertes bildeten, jährt sich sein Geburtstag im Oktober doch zum 200. Mal.

Riccardo Muti, dem Orchester seit mehr als einem halben Jahrhundert eng verbunden, fand bei seinem inzwischen siebenten Neujahrskonzert die so heikle Balance zwischen Lebensfreude und Melancholie, Übermut und Eleganz, Anmut und Kraft. So zart die warm getönten Stimmen der Holzbläser in der symphonisch angelegten Einleitung zum großen Konzertwalzer „Wein, Weib und Gesang“ (op. 333) ihre Motive intonierten, so innig das Cello seine Melodiebögen spann, so triumphal trat später das Hauptthema auf. Lustvoll ließ Muti die philharmonische Luxus-Kapelle immer wieder groß aufspielen, ohne dass deren Klang dadurch je dumpf indifferent geworden wäre. Mit klaren Zeichen schuf er Spannung durch eine fein differenzierte Dynamik und flexible Tempi, sodass den Walzern vor den aufschäumenden Schluss-Takten Raum für jene charakteristischen Momente schmerzlich-süßen Verweilens blieb.
Ein weiblicher Teenager
Gerahmt wurde das Konzert indes von zwei Märschen, die bei Muti kraftvoll, aber nicht martialisch daherkamen. Sie zeigen den Vater Strauss als politisch wendigen, rasch auf die aktuelle Situation reagierenden Zeitgenossen: Bekundete sein „Freiheits-Marsch“ (op. 226) Sympathien für die Ideale der Revolution von 1848, so huldigte der „Radetzky-Marsch“ (op. 228) einem Protagonisten der Reaktion. Ein wenig gilt das wohl auch für den im selben Jahr komponierten Walzer mit dem Titel „Die Ferdinandéer“. Aber Constanze Geiger war kaum erst ein Teenager, als ihr Opus 10 von Johann Strauss als Hommage an Kaiser Ferdinand I. uraufgeführt wurde. 1835 als Tochter eines Musikers geboren, gehörte Simon Sechter, bei dem Anton Bruckner einige Jahre später so fleißig den Kontrapunkt studieren sollte, zu ihren frühen Lehrern. Bald schon zählte die Presse das Mädchen zu den „wunderartigsten Erscheinungen der Kunstwelt“. Als Pianistin war sie so erfolgreich wie als Schauspielerin, bevor sie sich nach der Vermählung mit einem Adeligen (damals keine Selbstverständlichkeit) von der Bühne zurückzog (damals durchaus eine Selbstverständlichkeit). Sie starb 1890 in Paris. Kaum jemand erinnerte sich später des einstigen Wunderkindes. Jetzt aber publizierte Raimund Lissy, selbst Philharmoniker, eine umfangreiche Monographie über diese außergewöhnliche Frau. Und ihr früher Walzer von 1848, dessen „seelenvolle Weichheit und Zartheit“ die damalige Kritik anerkannt hatte, fand in Riccardo Muti einen engagierten Anwalt und also beim Neujahrskonzert die denkbar größte Bühne.

Die allein erhaltene Klavierfassung des charmanten Stückes musste von Wolfgang Dörner erst im Stile der damaligen Zeit neu orchestriert werden. Das Orchestermaterial selbst gehörte nämlich zu jenen Beständen der Strauss-Kapelle, die Eduard, der jüngste der drei Söhne, 1907 in einem beispiellosen Akt der Vernichtung den Flammen übergab. Stundenlang saß der alte Mann vor einem Fabrikofen und sah dabei zu, wie alles zu Rauch und Asche wurde, was sich in Jahrzehnten an Noten angesammelt hatte. Seine Motive sind unklar. Mag sein, dass er wirklich die Spuren einer Werkgenese tilgen wollte, die scharf mit der Vorstellung genialischen Schöpfertums dissoniert, geht man heute doch davon aus, dass all die Walzer, Märsche und Polkas in einem geradezu arbeitsteiligen Prozess gefertigt wurden: Der „Walzerkönig“, der sich selbst ironisch auch einmal als „Walzerfabrikant“ bezeichnete, übergab die von ihm notierten melodischen Einfälle seinen Mitarbeitern zur weiteren Ausformung, um sich nach der Schlussredaktion vor allem um das zu kümmern, was heute als „Branding“ bezeichnet wird.
Die Musik, die so entstand, ist kaum Ausdruck persönlicher Empfindungen; meistens verdankt sie ihre Entstehung ja auch ganz konkreten Anlässen. Wenn sie so meisterhaft gespielt wird wie jetzt unter Riccardo Mutis Leitung in Wien, schenkt sie auch heute noch Lebensfreude und hohen Genuss. Das Publikum im Goldenen Saal brach am Neujahrsmorgen zwar nicht in ein „wahres Wonnegewieher“ aus, dankte aber enthusiastisch für ein so stimmungs- wie temperamentvolles Konzert.